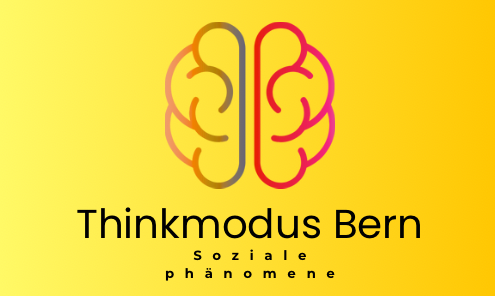Definition der Phänomene
Cybermobbing
Cybermobbing bezeichnet die absichtliche und wiederholte Belästigung, Bedrohung oder Erniedrigung einer Person über digitale Kommunikationsmittel wie soziale Netzwerke, Messaging-Dienste oder Online-Plattformen. Besonders häufig geschieht dies in geschlossenen Gruppen, wie Klassenchats, in denen Mitschüler gezielt angegriffen werden. Die Anonymität des Internets kann Täter ermutigen, aggressives Verhalten zu zeigen, während das Opfer unter psychischen Belastungen leidet. Cybermobbing kann zu ernsthaften emotionalen und psychischen Problemen führen, einschließlich Depressionen und sozialer Isolation.
Cyberbullying
Cybermobbing als einzelfälle. Cyberbullying bezeichnet das absichtliche, Belästigen, Bedrohen, Blossstellen oder Schikanieren einer Person mithilfe digitaler Kommunikationsmittel wie Smartphones, sozialen Medien, Messaging-Diensten oder Online-Plattformen. Im Gegensatz zu traditionellem Mobbing zeichnet sich Cyberbullying durch die permanente Verfügbarkeit und Anonymität des Internets aus, wodurch die Opfer rund um die Uhr erreicht und die Angriffe oft öffentlich für ein großes Publikum sichtbar gemacht werden können.
- Cyberbullying legt den Schwerpunkt auf gezielte, aggressive Handlungen wie Beleidigungen oder Demütigungen mit einem eher individuellen Charakter.
- Cybermobbing betont oft das systematische und langfristige Schikanieren, das meist von Gruppen ausgeht und sozial isolierend wirkt.
Cybergrooming
Cybergrooming bezeichnet den Prozess, durch den sich Erwachsene über digitale Kanäle, wie soziale Medien oder Chatrooms, das Vertrauen von Minderjährigen erschleichen, um sexuelle Übergriffe vorzubereiten. Pädophile nutzen dabei verschiedene Techniken, um eine emotionale Bindung aufzubauen, und versuchen, die Kinder zu manipulieren, um sie zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Dies kann in verschiedenen Formen geschehen, einschliesslich sexueller Anfragen, die schrittweise gesteigert werden, bis das Kind sich unwohl fühlt oder manipuliert wird. Cybergrooming stellt eine ernsthafte Gefahr für die Sicherheit von Kindern im Internet dar.
Cybertorsion/Sextorsion
Cybertorsion oder Sextorsionist ein Begriff, der sich auf die Erpressung einer Person durch die Androhung der Veröffentlichung kompromittierender Bilder oder Videos bezieht, die online geteilt wurden. Diese Form der digitalen Erpressung kann schwerwiegende psychische Folgen für die Betroffenen haben, da sie in ihrer Privatsphäre verletzt werden und oft in Angst leben, dass ihre intimsten Momente öffentlich gemacht werden. Cybertorching findet häufig in Beziehungen statt, kann aber auch unter Bekannten oder im Rahmen von Gruppeninteraktionen geschehen.
Sexting
Sexting bezeichnet das Teilen von sexuellen Inhalten, wie Bildern oder Nachrichten, über digitale Kommunikationsmittel. Dies kann einvernehmlich zwischen Partnern geschehen, birgt jedoch Risiken, insbesondere wenn diese Inhalte unabsichtlich verbreitet oder in die falschen Hände geraten. Bei Jugendlichen kann Sexting zu ernsthaften sozialen und rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich Mobbing, emotionalem Stress und strafrechtlichen Ermittlungen.
Toxische Kommunikation
Toxische Kommunikation beschreibt eine Form der Interaktion, die von negativem Verhalten, beleidigenden Äußerungen oder Manipulation geprägt ist. Sie kann in verschiedenen Kontexten auftreten, insbesondere in Klassensituationen oder Jugendgruppen. Toxische Kommunikation beeinträchtigt das Wohlbefinden der Beteiligten und kann zu einem feindlichen Umfeld führen, in dem Mobbing, Konflikte und psychische Belastungen zunehmen. Jugendliche sind besonders anfällig für toxische Kommunikationsmuster, da sie sich in einer Phase der Identitätsfindung befinden und häufig von Gruppenzwang betroffen sind.
Fake News
Fake News sind absichtlich verbreitete falsche Informationen, die oft in Form von Artikeln, Videos oder Posts in sozialen Medien erscheinen. Diese falschen Nachrichten können dazu dienen, Meinungen zu manipulieren, Angst zu schüren oder eine bestimmte Agenda zu verfolgen. Besonders bei Jugendlichen können Fake News zu einer verzerrten Wahrnehmung der Realität führen und deren kritisches Denkvermögen beeinträchtigen. In der digitalen Welt ist es wichtig, Informationen zu überprüfen und die Quellen zu hinterfragen, um der Verbreitung von Fake News entgegenzuwirken.
Deepfakes
Deepfakes sind künstlich erzeugte oder manipulierte Medieninhalte, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) realistische, aber falsche Darstellungen von Personen oder Ereignissen erzeugen. Besonders häufig werden Videos und Audiodateien verändert, um Gesichter auszutauschen oder Stimmen täuschend echt nachzuahmen.
Diese Technologie wird sowohl für kreative als auch für schädliche Zwecke genutzt. Während Deepfakes in der Film- und Unterhaltungsbranche neue Möglichkeiten bieten, stellen sie zugleich eine Gefahr dar: Sie können zur Verbreitung von Fake News, Identitätsbetrug, Cybermobbing oder politischer Manipulation eingesetzt werden. Im Rahmen von ThinkModus vermitteln wir Fachkräften und Jugendlichen, wie Deepfakes funktionieren, welche Risiken sie bergen und wie man sie erkennt. Kritische Medienkompetenz ist entscheidend, um Manipulation zu durchschauen und verantwortungsvoll mit digitalen Inhalten umzugehen.
Radikalismus
Radikalismus bezieht sich auf die Akzeptanz oder Förderung extremer ideologischer Positionen, die häufig mit Gewalt oder anderen extremen Massnahmen verbunden sind. Junge Menschen sind besonders anfällig für Radikalismus, insbesondere in der Pubertät, wenn sie ihre Identität und Zugehörigkeit suchen. Filterblasen und Bubbles im Internet können diese Anfälligkeit verstärken, indem sie den Zugang zu extremistischen Inhalten erleichtern und die Möglichkeit bieten, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Dadurch können Jugendliche schnell manipuliert werden und in extremistische Gruppen abdriften.
Filterblasen
Filterblasen sind das Ergebnis von personalisierten Algorithmen, die bestimmen, welche Inhalte ein Nutzer online sieht. Diese Algorithmen berücksichtigen das Nutzerverhalten und zeigen vorwiegend Inhalte, die bestehende Überzeugungen bestätigen. Dies führt zu einer selektiven Wahrnehmung, die das kritische Denken einschränkt und den Zugang zu verschiedenen Perspektiven minimiert. Besonders für Jugendliche ist dies problematisch, da sie dadurch in ihrer Meinungsbildung und Identitätsfindung beeinträchtigt werden können.
Bubbles
Bubbles beziehen sich auf geschlossene digitale Räume, in denen Nutzer hauptsächlich mit Gleichgesinnten interagieren und Informationen austauschen. Diese Bubbles entstehen oft in sozialen Netzwerken und führen zu einer Einschränkung der Vielfalt der Meinungen und Perspektiven. Innerhalb solcher Bubbles wird die kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themen reduziert, was die Polarisierung von Meinungen und die Verstärkung von Extremismus fördern kann. Besonders bei jungen Menschen können Bubbles zur Verfestigung extremer Überzeugungen beitragen.
Diese Definitionen und Erklärungen helfen, die verschiedenen virtuellen Phänomene zu verstehen, die Jugendliche betreffen, und bilden eine Grundlage für präventive Massnahmen und Aufklärung.
Deep Fakes
Deep Fakes sind realistisch wirkende, jedoch manipulierte digitale Inhalte, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen erstellt werden. Dabei werden Gesichter, Stimmen oder andere visuelle und akustische Merkmale so verändert oder in neue Kontexte gesetzt, dass es schwierig ist, die Manipulation zu erkennen. Deep Fakes werden häufig eingesetzt, um falsche Informationen zu verbreiten, Persönlichkeiten zu imitieren oder Personen in kompromittierende Situationen zu bringen, und stellen somit eine erhebliche Bedrohung für die Integrität von Informationen und die digitale Sicherheit dar.

©Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.